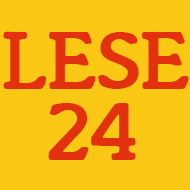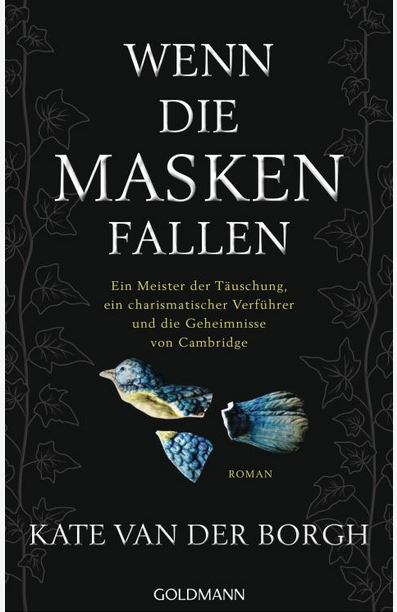Kate van der Borgh: Wenn die Masken fallen, Aus dem Englischen von Kristof Kurz, Goldmann Verlag, München 2025, 432 Seiten, €24,00, 978-3-442-31789-9
„Von meinen Altersgenossen kannte ich nur die Posen typischer Heranwachsender: den schlurfenden Gang, der Desinteresse signalisieren sollte, oder eine gekrümmte Haltung, die dazu diente, Bierdosen oder Zigaretten zu verbergen. Er jedoch hatte eine Leichtigkeit und gleichzeitig eine Gravitas an sich, wie sie sonst nur Lehrer, Polizisten oder Politiker zu eigen ist. Ich hatte das Gefühl, wie ein Luftballon hin und her zu treiben, während er wie eine Statue war, die seit Jahrhunderten an ihrem Platz stand.“
Der namenlose, ja unscheinbare Erzähler dieses Romans, der als Fagottspieler an seiner staatlichen Schule irgendwo in Nordengland bereits ein Außenseiter war, erhält ein Stipendium an einem College in Cambridge. Vom ersten Tag an bewundert er Bryn Cavendish, den Mathematikstudenten, der mit seine Clique allen auffällt. Als Mensch mit vielen Talenten fasziniert er den Erzähler und zieht ihn auch mit seinen Zauberkunststücken und seiner unbegreiflichen Magie und Aura in seinen Bann. Dass mit Bryn irgendetwas Tragisches geschehen sein muss, stellt sich sehr schnell heraus.
Kate van der Borgh erzählt ihren Debütroman, eine Verbeugung vor dem Genre Dark Academia, zeitversetzt immer im Wechsel. Zum einen lernen die Lesenden den Erzähler, der in der Gegenwart ganz unspektakulär als Musiklehrer und Chorleiter arbeitet, kennen und sie begleiten ihn in die Zeit auf dem College. Seine Erinnerungen umkreisen den charismatischen, wilden wie auch charmanten Bryn, Sohn aus reichem Hause, und seine Entourage, die Begegnungen mit ihm und die Schuld, die der Erzähler angeblich auf sich geladen hat. Der Anlass für diesen Rückblick ist die Bitte von Frances Cavendish, der Mutter von Bryn, dass der Erzähler Stipendiaten in Cambridge auswählen soll.
Vor Ort dann scheint der Erzähler, der auch am College für seinen nordenglischen Akzent belächelt wurde, nach alten Geistern und Absolution zu suchen, denn immer intensiver taucht in seinen Erinnerungen der von ihm bewunderte Bryn auf. Dieser konnte nicht nur prämierte Essays über Verfechter des Okkultismus schreiben, sondern auch wunderbar singen, Menschen begeistern und manipulieren. Als schillernde Figur, die zu gern mit viel Alkohol feiert, zeigt Bryn nach und nach auch seine Schattenseiten. Um Bryn nahe zu sein, freundet sich der Erzähler mit seiner Cousine Berenice an. Sie hat allerdings wenig für ihren Cousin übrig, denn Studierende, die bei ihm in Ungnade fielen, mussten dies früher oder später bitter büßen. Der Erzähler, der für Komponisten wie Britten, Schostakowitsch, aber auch Peter Warlock schwärmt, glaubt, dass Bryn ihn in seinen Freundeskreis aufgenommen hat. Er gibt ihm sogar einen Vornamen und nennt ihn John, obwohl dies nicht stimmt und zeigt, wie gleichgültig ihm eigentlich Menschen sind. Deutlich wird aber auch, dass in den Reflexionen der Hauptfigur die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen und dass alle unzuverlässige Erzähler ihres eigenen Lebens sind. Was für den Erzähler von allergrößter Bedeutung im Rückblick ist, haben andere ganz anders interpretiert oder es spielt gar keine Rolle. Wie sich der Erzähler in seinen Erinnerungen immer mehr verfängt, beschreibt die englische Autorin voller Spannung und atmosphärisch präzise. Da sie wichtige Informationen, z.B. was mit Bryn nun geschehen ist und welchen Anteil der Erzähler hat, lange wie ein Geheimnis zurückhält, kann man, wenn die Geschichte einen gefesselt hat, das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Zumal die Lesenden natürlich spüren, dass die Wahrnehmungen der Hauptfigur eher seinen Wünschen entsprechen als den Tatsachen.
Wer sich gern in den Sälen, Fluren, Zimmern und Gärten englischer Colleges verliert und Freude an dunklen Geheimnissen hat, der sollte diesen sprachlich überzeugenden Roman unbedingt lesen!