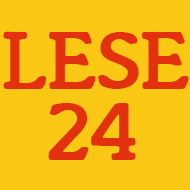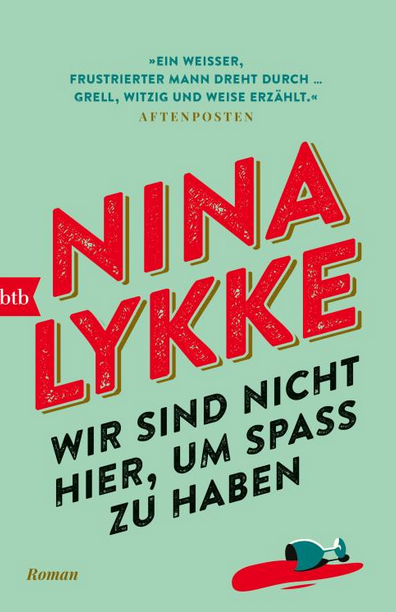Nina Lykke: Wir sind nicht hier, um Spaß zu haben, Aus dem Norwegischen von Sylvia Kall, Ina Kronenberger, btb Verlag, München 2025, 320 Seiten, €17,00, 978-3-442-77445-6
„Also ist es nicht schlimm, dass er nichts mehr zustande bringt, denn Bücher werden ohnehin nicht mehr gelesen, sondern bloß in alte Telefonzellen gestopft oder verschenkt.“
Der ehemals sehr erfolgreiche Schriftsteller Knut A. Pettersen geht nun auf die sechzig zu und weiß, dass er für den Literaturbetrieb keine Rolle mehr spielt. Niemand will ihm ein Stipendium geben, niemand interessiert sich für seine Schreibblockade, nicht mal seine Ex-Frauen oder sein mittlerweile erwachsener, sehr wortkarger Sohn Lukas. Und wenn er dann mal zu einer Lesung in eine Schule eingeladen wird, dann langweilen sich die Jugendlichen oder sagen ihm ziemlich unverhohlen ins Gesicht, dass sie zwar eine Hausarbeit über sein Buch schreiben werden, aber lesen wollen sie es nicht. Und die Krönung ist, dass die Lehrerin empathisch neben den Jugendlichen steht und nichts dabei findet, da die Schüler und Schülerinnen ja so unter Druck stehen. In solchen Momenten kann Pettersen nur eins, ausrasten. Austauschen kann sich Pettersen allein mit seinem Nachbarn, der allerdings immer nur mit seiner Affäre mit einem pakistanischen Familienvater beschäftigt ist.
Doch dann trudelt eine Einladung bei Pettersen ins Haus. Er soll, wahrscheinlich ist er nur dritte Wahl, an einem Podiumsgespräch bei einem legendären Literaturfestival in Lillehammer mit dem Thema „ Untreue im Leben und in der Literatur“ teilnehmen. Keine Frage, er braucht das Honorar und die paar Tage kostenlose Verpflegung und Logis. Die weiteren eingeladenen Gäste sind der schreibende Ehemann von Pettersens Ex-Ehefrau Lore und die Autorin, die angeblich gegen ihren Willen von Pettersen begrapscht wurde und ihre Empörung in einem autofiktionalen Roman Luft gemacht und ihren Peiniger sogar mit Klarnamen genannt hat. In einem Rückblick erinnert sich der Autor ungern an diesen ziemlich alkoholisierten Abend und in seiner Wahrnehmung übernahm den eher aktiven Teil die vermeintlich missbrauchte Autorin, denn er verhält sich Frauen gegenüber eher passiv. Als er noch im Glanz seines Erfolgsbuches stand, konnte er sich vor weiblichen Angeboten kaum retten. Um so erstaunlicher war, dass diese Autorin sich vor drei Jahren an seinen Hals geworfen hat. Immer wieder wundert sich Pettersen, dass Frauen seltsam auf ihn reagieren. Er kann einfach nicht herausfinden, was er, der alte weiße Mann, nun falsch gemacht hat.
„Es ist so, als hätte er keine Persönlichkeit, keinen festen Kern. Nur eine dünne Soße, die hierhin und dorthin fließt.“
Mit vielen Seitenhieben thematisiert Nina Lykke die sogenannte „Wirklichkeitsliteratur“, die Nina Lykke als „Fake-Genre“ bezeichnet, denn nichts wird wirklichkeitsnah dargestellt und verändert sich schon im Moment des Aufzeichnens. Und natürlich fragt sich jeder Lesende, haben Autoren einfach keine Fantasie mehr, Geschichten zu erfinden. Müssen sie jeden Fitzel ihres Privatlebens, denn sie angeblich erlebt haben, in die Öffentlichkeit zerren?
Pettersen in all seinen niederschmetternden Demütigungen, aber auch auf den Zeitgeist bezogen sehr realistischen Ansichten zu folgen, ist mehr als unterhaltsam. Die Figur des Pettersen steht für die Unsicherheit, die viele im Angesicht von Regeln befällt, die niemand mehr versteht, insbesondere wenn es um Trickerwarnungen geht oder diese absurde Entscheidung der Verlage, Sensitivity-Reader an Manuskripte zu setzen und deren Beurteilung als Kriterium zu nehmen, um Bücher zu veröffentlichen.
„Hätte man eine Person, die in Frankreich geboren, aber in Pakistan aufgewachsen ist, die Aufgabe übertragen, ein Manuskript zu lesen, das von einem Norweger handelt, aber von einem Pakistaner geschrieben worden ist, um eventuelle kulturelle Fehler zu korrigieren?“
Kluger Blick auf die eigenwillige Literaturwelt, der Autoren wie Lektoren und Lesenden, von denen es hoffentlich noch viele gibt.