Karl Ove Knausgård: Lieben, Aus dem Norwegischen von Paul Berf, Luchterhand Literaturverlag, München 2012, 763 Seiten, €24,99, 978-3-630-87370-1
„Das Einzige, worin ich einen Wert erblickte, was weiterhin Sinn produzierte, waren Tagebücher und Essays, die Genres in der Literatur, in denen es nicht um eine Erzählung ging, die von nichts handelten, sondern nur aus einer Stimme bestanden, der Stimme der eigenen Persönlichkeit, einem Leben, einem Gesicht, einem Blick, dem man begegnen konnte. Was ist ein Kunstwerk, wenn nicht der Blick eines anderen Menschen?“
War ich bei Karl Ove Knausgårds erstem Band „Sterben“ noch skeptisch, ob sein Konzept vom realen Schreiben über das eigene Leben wirklich aufgeht, so hat mich „Lieben“ vollkommen überzeugt.
Ohne lange Einleitung zieht der norwegische Autor, der mit seiner Familie nun in Malmö wohnt, den Leser in die Handlung hinein. Diese umfasst seine tagtäglichen Mühen und Freuden als Schriftsteller, Ehemann, Hausmann, Vater, Nachbar, Bekannter, Freund, Sohn, Bruder, Schwager und Schwiegersohn. Aus immer wieder neu erzählten detailversessenen Episoden heraus blickt Knausgård in die Vergangenheit, reflektiert erneut über die schwierige Beziehung zum Vater, seine erste Begegnung mit seiner zweiten Frau, dem Ende mit der ersten, das unbändige Glück im ersten Moment Vater zu sein und die Abgründe, die sich später auftun. Er umkreist genau sein Lebensmodell mit allen Schwächen und Kanten, und erkennt, dass seine schwedische Frau Linda Nähe von ihm erwartet, die er als einengend empfindet. So entstehen im Alltagsleben immer wieder Reibungspunkte, die der in sich gekehrte Autor aufnimmt und minutiös beschreibt.
Er kämpft seinen privaten Kampf mit der veränderten Geschlechterrolle aus, die ihn zu etwas macht, was er gar nicht möchte.
„Das alltägliche Leben mit seinen Pflichten und wiederkehrenden Abläufen war etwas, das ich ertrug, nichts, worüber ich mich freute, nichts, was mir einen Sinn gab und mich glücklich machte. Es ging nicht darum, dass ich keine Lust hatte, den Fußboden zu putzen oder Windeln zu wechseln, sondern um etwas Fundamentaleres, dass ich in dem mir nahen Leben keinen Wert erblickte, mich stattdessen unablässig fortsehnte und dies schon immer getan hatte. Das Leben, das ich führte war folglich nicht mein eigenes. Ich versuchte es zu meinem zu machen. Das war mein Kampf, den ich ausfocht, denn das wollte ich doch.“
Präzise und dabei unverkrampft, ohne in irgendeiner Weise korrekt sein zu wollen, schildert Knausgård sein Problem als Mann mit der Kinderbetreuung, die er bei seinem ersten Kind Vanja übernommen hatte, denn seine Frau will ihre Ausbildung beenden. Als sich schnell zwei weitere Kinder ankündigen, verfliegt die Angst mit dem Kinderwagen gesehen zu werden. Die existentiellen Krisen und das Leiden an der Realität bleiben jedoch. Die Mühen des Alltags und seine Banalität drücken die Beziehung des Norwegers zu seiner Frau schnell in die Knie. Vanja stellt fest, dass ihre Eltern wenig Geduld haben und viel schreien. Das ist hart, aber real.
Knausgård beobachtet gern Menschen und fällt Urteile, wagt sich nicht nah an sie heran und scheut Konflikte. Nur mit seinem norwegischen Freund Geir, der in Stockholm lebt und immer die erste Anlaufstelle ist, kann sich Knausgård in langen fachsimpelnden Gesprächen vertiefen. Beide lästern gern über die Schweden und ihre pedantische Art, versinken in philosophischen Disputen und tiefgründigen Diskussionen über Literatur, alles in den Fortlauf der Handlung eingebunden.
Führt uns Karl Ove Knausgård wieder etwas vor Augen, was wir in unserem Alltag auch wieder vergessen haben, nicht mehr wahrnehmen, verdrängen, untergehen lassen? „Ich wollte mir die Welt zurückerobern“, sagt der Autor und treibt es in seinem Mammutprojekt, das sechs Bände umfassen soll, voran.
Schreiben heißt für ihn, dass Fiktion in einer Welt der Bilder sinnlos ist. Allerdings muss das Schreiben der eigenen Biographie auch gekonnt sein. Knausgård besticht überzeugend durch seinen interessanten Erzählstil und seine Beobachtungsgabe.
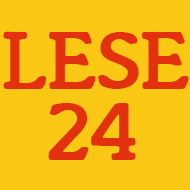
Schreibe einen Kommentar