Karl Ove Knausgård: Im Frühling, Aus dem Norwegischen von Paul Berf, Luchterhand Literaturverlag, München 2018, 249 Seiten, €22,00, 978-3-630-87512-5
„Ich mochte mich selbst, wenn ich mit den Kindern zusammen war, es war eine der großen Freuden, die sie mir schenkten, und ich mochte niemanden mehr als sie. Ein neues Kind würde mehr Liebe hervorbringen und es mir unmöglich machen, jemals ein anderes Leben als dieses, mit der Familie, zu wählen.“
Nach dem Winter und dem Herbst folgt nun ein Buch über den Frühling. Die Natur erblüht und Karl Ove Knausgård erzählt bis in kleinste private Details auch in diesem Band von seinem vierten Kind, das vor kurzem geboren wurde. Namen werden nie genannt, es bleibt bei Bruder oder Schwester oder Mutter, Großmutter und doch wirken die Beschreibungen dieses einen Tages äußerst persönlich. In Rückblenden umkreist der norwegische Autor Erinnerungen an den eigenen Vater und seine Rolle den Kindern gegenüber, es geht um die Zeit bevor das vierte Kind geboren wurde, um den Aufenthalt in Australien und vor allem geht es um die dunklen Zeiten, die Karl Ove Knausgårds Frau durchleben muss. Immer wieder verfällt sie in schwere Depressionen und alle Arbeit bleibt an Knausgård hängen. So auch an diesem Tag, denn seine Frau ist im Krankenhaus.
„In der Dunkelheit, in der sie daraufhin lebte, gab es nur sie und den Schmerz, den sie empfand. Das weiß ich, mein Kind, weil ich es sah.“
Etwas chaotisch, sogar der Gerichtsvollzieher stand schon vor der Tür, weil Knausgård die Rechnungen nicht bezahlt hat, ist der Aufbruch ins Krankenhaus. Als klar wird, dass er tanken muss, entdeckt er, dass seine Kreditkarte zu Hause geblieben ist. Es fehlt auch das Milchfläschchen und ein schreiendes Kind zerrt an den Nerven.
Karl Ove Knausgård erinnert sich in seinen Gedankenströmen immer wieder an seine Ehe, an einen „Vorfall“ und Termin bei der Kinderfürsorge, es geht natürlich um das Wohl der Kinder, Knausgårds Unbeherrschtheit, die ihm im Nachhinein unendlich leid tut, auch um die Distanz zwischen der Elternwelt in den 1970er Jahren und der Kinderwelt.
Diese Aufzeichnungen soll seine jüngste Tochter, die anderen Kinder sind bereits zehn, acht und sechs Jahre, lesen, wenn sie sechzehn ist.
Karl Ove Knausgårds Offenheit verblüfft in vielen Passagen und der Blick in seine Seelenleben. Das Prinzip Ehrlichkeit und die Ansprache an die eigene Tochter schafft eine ungeheure Nähe, die die Faszination beim Lesen ausmacht und auch bisschen den Voyeurismus schürt, zumal der informierte Leser weiß, dass die Ehe der Knausgårds inzwischen geschieden ist. Wer außerdem die voluminösen Bände des Autors über sein Leben kennt, ahnt vieles, was in dem neuen Band nicht ausgesprochen wird.
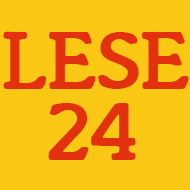
Schreibe einen Kommentar