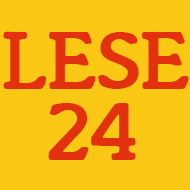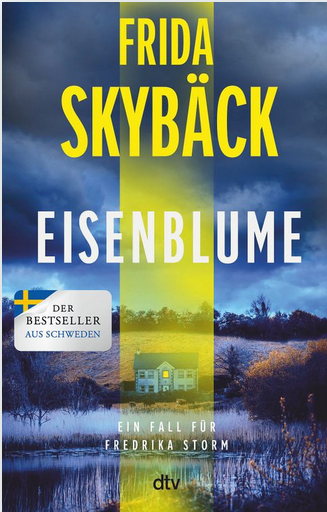Frida Skybäck: Eisenblume, Ein Fall für Fredrika Storm, Aus dem Schwedischen von Julia Gschwilm, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2025, 409 Seiten, €17,00, 978-3-423-26429-7
„Sie hatte eine Reihe falscher Entscheidungen getroffen, weshalb ihre Kompetenz infrage gestellt wurde, aber sie wollte ihre Stelle nicht verlassen. Die Aufklärung von schweren Verbrechen war, was sie am meisten liebte, und machte ihre Identität aus. Sie würde alles dafür tun, um bleiben zu dürfen.“
Die Ermittlerin Fredrika Storm ist auf der Suche nach ihrer Mutter Annika, die sie als Kind verlassen hat. Und sie hatte wohl im Vorgängerband einen harten Fall zu bearbeiten, in dem ihre eigene Familie verwickelt war. Wie dies alles zusammenhing, wird im neuen Band nicht aufgerollt, was den Einstieg schwierig macht. Eigenwillig und von ihrem Beruf besessen neigt Fredrika dazu, eigenmächtig Ermittlungswege einzuschlagen, die ihren Vorgesetzten kaum gefallen. Fredrika lebt in Lund und ist mit dem Rechtsmediziner Jonas Chen liiert, was ihrem, auch das wird nicht klar, Ermittlungspartner Henry Calment, der dazu neigt, gern sein Wissen weiterzugeben, nicht so richtig behagt. Dabei scheint Jonas ein verständnisvoller und liebenswerter Mensch zu sein.
Als dann im Sankt-Lars-Krankenhaus, das zu Anfang der 1990er Jahre geschlossen wurde, eine eingemauerte Leiche gefunden wird, beginnt ein Lauf gegen die Zeit, die Presse, die sozialen Medien und eine sogenannte PE – Gruppe, die private Ermittlungen führt. Ein alter Fall rückt erneut in den Focus, der die Öffentlichkeit auch durch das Buch von Greta Sparre beschäftigt. Sie ist die wohlhabende Schwester der siebzehnjährigen Marie-Louise Sparre. Am 17.10.1987 sind sie und Tommy Svensson aus der Abteilung C, einem Bereich der Psychiatrie, verschwunden. In ihrem Buch behauptet die äußerst selbstbewusste Greta, dass Tommy ihre Schwester entführt und getötet haben soll. Energisch kritisiert sie, möglicherweise zu recht, die damalige Polizeiarbeit und nervt erneut Fredrika und Henry mit ihrem permanenten Aktionismus. Allerdings stellt sich nun heraus, dass das Opfer des Tötungsdelikts in dem heruntergekommenen Gebäude Tommy Svensson ist. In immer neuen Gesprächen, je nach Wissensstand, befragen Fredrika und Henry das damalige Pflegepersonal, den Hausmeister und die Ärzte. Alle erzählen nach dreißig Jahren fast haargenau immer wieder die gleiche Geschichte, wie sie an dem regnerischen Abend des Verschwindens die beiden Patienten vergeblich gesucht haben.
Warum die beiden Jugendlichen in die psychiatrische Anstalt eingeliefert wurden, können die Ermittler kaum nachvollziehen. Marie-Louise stand unter der strengen, fast manischen Kontrolle des despotischen Vaters, der ihre pubertären Eskapaden unterbinden wollte. Tommy war weder aggressiv, noch wirklich extrem verhaltensauffällig. Wie die Mediziner zur damaligen Zeit mit wahrhaft psychisch Kranken, die sie als minderwertiges Leben angesehen haben, umgegangen sind, ist im Nachhinein auch im progressiven Schweden beim Lesen schwer zu ertragen. Dass Marie-Louise und Tommy diesen grausigen Ort verlassen wollten, ist absolut verständlich. Unerklärlich ist auch, wie es sein kann, dass gerade in diesen Einrichtungen Ärzte, die sich einiges zu schulden haben kommen lassen, weiterhin geschützt von der Krankenhausleitung beschäftigt wurden. Die Ermittler, deren Teams das untertunnelte Krankenhausgelände und jede Wand durchsucht haben, laufen gegen eine Mauer des Schweigens an und haben nicht die Befugnis, damalige Patienten zu befragen. Doch Fredrika findet sich damit nicht ab und sucht einen Weg, um an die Krankenliste heranzukommen. Als dann der einstige, ziemlich mürrische Hausmeister Roger Krantz, der offensichtlich einen der Ärzte erpresst hat, auf dem Krankenhausgelände zu Tode kommt und Fredrika inoffiziell mit einer Patientin, die 1987 in der Abteilung C behandelt wurde, sprechen kann, beginnt die Geschichte trotz Rückschlägen endlich an Tempo aufzunehmen. Zwar gibt ein todkranker Arzt kurz vor seinem Suizid einen Hinweis auf Marie-Louises Grabstelle, doch dies stellt sich als Irrtum heraus.
Frida Skybäck umkreist trotz einiger ablenkender Nebenhandlungen, die sich auf die Privatleben der Ermittler Fredrika und Henry beziehen, einen spannenden, sehr glaubhaft geschriebenen Fall, der davon erzählt, wie die Gesellschaft mit angeblich kranken und wirklich psychisch beeinträchtigten Menschen umgegangen ist. Dass die polizeiliche Aufklärung auch vor dreißig Jahren nicht erwünscht war, wirft ebenfalls ein dunkles Licht auf die schwedische Gemeinschaft.
Da einige Fäden in der Handlung, die mal aus der personalen Erzählebene von Fredrika und dann wieder aus Henrys Sicht geschrieben ist, offen sind, wird demnächst auch ein dritter Band folgen.