Beate Dölling: Du bist sowas von raus! Echte Geschichten aus der Arche, Gabriel Verlag, Stuttgart 2013, 298 Seiten, €14,95, 978-3-522-30354-5
„Also eins weiß Ela ganz genau: Sie will erst Kinder haben, wenn sie verheiratet ist und ein schönes Haus hat und einen Mann, auf den man sich verlassen kann.“
Sie heißen Ela, Lilly, Basha, Pearl, Vin oder Romy, sie wohnen in Berlin, Hamburg oder München, sie müssen für sich und ihre Familien viel zu viel Verantwortung übernehmen. Die Jungen und Mädchen leben unbehütet in ärmlichen Verhältnissen, in denen oftmals für Zigaretten und Alkohol Geld ausgegeben wird, aber nicht für die Dinge des täglichen Lebens. Die Kinder und Jugendlichen kennen Gewalt innerhalb und außerhalb der Familie und sie wissen, dass sie sich im seltensten Fall auf ihre Mütter oder Väter verlassen können. Das Zentrum dieser Familien ist der Flachbildfernseher und die bunten Werbefilme, die eine Welt vorgaukeln, die es so nie geben wird.
Vin findet im strömenden Regen einen Holztisch. Zwar passt er nicht mehr in die kleine Wohnung der Mutter, aber der Jugendliche verbindet mit dem Tisch eine Hoffnung. Endlich sollen sich die ewig zerstrittenen Eltern, Vins unzuverlässiger Vater lässt sich alle paar Wochen mal sehen, gegenüber sitzen und sich ansehen. Gut, sie können auf den Tisch schlagen, um ihre Argumente zu verstärken, aber sie sollen nicht wieder fluchend einander hinterherrennen und sich weh tun.
Der Tisch soll endlich Ruhe in die Familie bringen. Vins kleine Halbschwester benutzt ihn gern, um auf ihm zu malen. Zum ersten Mal wird nicht verkrampft auf dem Sofa vorm Fernseher das Essen eingenommen, sondern alle drei sitzen mit ihren Tellern am Tisch. Und letztendlich wird auch der Vater am Tisch sitzend sich anhören müssen, was Vin ihm zu sagen hat.
Einsam und liebebedürftig sind die Mädchen und Jungen, die in kinderreichen Familien leben müssen. Die 12-jährige Lilly, die eigentlich Amanda heißt, sehnt sich nach den „guten Minuten“ der Mutter, in denen sie sich ihr zuwendet. Aber so schnell wie diese da sind, können sie auch wieder verschwinden. Lilly kümmert sich um die jüngeren Geschwister, die dreijährigen Zwillinge, die sich nicht ums Spielzeug schlagen, sondern um die Fernbedienung vom Fernseher, Ramona und Mickey. Wenn die Mutter wiedermal vergessen hat einzukaufen, gibt es Toastbrot mit Ketchup oder gar nichts zu essen. Verbraucht sieht Lillys junge Mutter aus, die wiedermal einen neuen Kerl hat. Mit ihm soll alles anders werden. Es wird geraucht, getrunken und geträumt. Lilly kann ihren inneren Frust, die angestaute Wut nur durch Aggressionen gegen andere loswerden. Und dann ist sie auch immer wieder da, die Angst vor dem Jugendamt, den scharfen Blicken der Lehrer, die Erwartungen an sie. Lilly könnte aufs Gymnasium gehen, aber die Mutter, die nicht mal einen Hauptschulabschluss hat, da ihr erstes Kind kam, als sie 15 Jahre alt war, sieht in ihrer Tochter nur jemanden, der hoffentlich bald arbeiten kann. Letztendlich soll Lilly, wenn der Traum der Mutter von Haus und Garten und neuem Mann in Erfüllung geht, in eine Wohngruppe abgeschoben werden.
Lilly vermisst die mütterliche Zuneigung, auch Ela muss darauf verzichten. Dabei stellen die Kinder sich in jeder Situation vor ihre Mütter, auch wenn sie sich ab und zu für sie schämen. Elas Mutter hat nur noch ihre ältere Tochter, denn Eileen, Taylor und Michelle leben in Pflegefamilien. Seit der Mutter eine so genannte „Bindungsstörung“ attestiert wurde, versteckt sie sich rauchend im Bett. Ela hofft jeden Tag darauf, dass die Mutter die Wohnung wieder verlässt und die Geschwister zurückholt. In ihrem Leben soll alles anders werden. Im Chat lernt die Minderjährige einen erwachsenen, dubiosen Mann kennen, der sie beschenkt, sie mit seiner angeblichen Liebe umgarnt, sich mit ihr sogar verabredet. Er wird nicht ihr Traumprinz, er landet im Bett der Mutter.
Spacko nennen die Kinder die neuen Männer ihrer Mütter, sie wissen, dass sie von ihnen nicht viel zu erwarten haben. Pearl hasst den „schönen Micha“, der sich in ihrer Wohnung breit macht und die jüngeren Geschwister sexuell belästigt. Gern würde sie ihrer Mutter die Wahrheit sagen, aber diese hält immer nur zu ihrem neuen Lover.
Als Pearl ihre jüngeren Geschwister mit Micha im Bett sehen muss, hetzt sie die Hunde auf ihn. \r\n\r\nRomy ist die große Ausnahme, ihr Vater ist anwesend, lebt sogar mit der Familie zusammen. Aber sie wünschte, er wäre weit fort, denn sie wird von ihrem versoffenen, sadistischen Vater regelmäßig grausam verprügelt. Ihre Geschwister verstecken sich, wenn es los geht und die Mutter stellt das Radio lauter.
„Wie sie bestraft wird, hängt nicht nur von ihm ab. Es kommt auf ihre Bereitschaft ab, die Schläge tapfer und einsichtig entgegenzunehmen. Weinen und Lachen wirken sich ungünstig aus.“
Hilflos fühlt sich auch der phantasiebegabte Tim, der seit Kurzem mit der Mutter, die das „Abharzen“ dem Arbeiten vorzieht, nach Berlin gezogen ist. Er fühlt sich nicht wohl in seiner Klasse, in der Jungen ihn mobben, weil er keine Markenklamotten trägt. Tim sehnt sich nach dem normalen Leben, er schämt sich für die kleine Wohnung, das Außenklo, die Ofenheizung, das abgenutzte Geschirr oder die wackligen Möbel. Als Fred, ein Mitschüler, ihn zu sich nach Hause einlädt, fühlt sich Tim wohl und unwohl zugleich. Mit welchen Gedanken wird der Freund, der in einem schönen Haus mit tollem eigenen Zimmer und allem Luxus wohnt, sein Zuhause sehen? Als Tims Mutter ihrem Jungen eine Nike-Jacke schenkt, entdecken die Mitschüler sofort, dass sie ein Fake ist. Fred berührt das kaum. Er steht eines Tages vor Tims Wohnungstür und ist fasziniert vom herrlichem Ausblick über die Stadt, vom Dachboden und all den Abenteuern, die er mit seinem Freund erleben kann. Ein Lichtblick – diese Jungenfreundschaft – unter all den wahren, bedrückenden Geschichten!
Beate Dölling hat genau recherchiert, hat sich vieles von betroffenen Kindern erzählen lassen, ohne sie auszufragen, und mit Erwachsenen gesprochen, die in der Arche arbeiten. In ihren „echten Geschichten“ verdichtet die Autorin das Erfahrene, das nüchtern betrachtet, gängige Klischees über Harz IV-Empfänger spiegelt, aber durch die Perspektive der Kinder unendlich berührt und bewegt. Aus dem Blickwinkel der Kinder und Jugendlichen jedoch, die keine Regeln kennen und auch keine Normalität des Alltags, entsteht ein neues Bild vom Leben am Rand der Gesellschaft. Die Berliner Autorin verdeutlicht mit viel Empathie, was ihre Protagonisten denken, was sie erwarten oder womit sie nicht fertig werden. Oftmals auf sich allein gestellt versteht der Leser die inneren Kämpfe der Kinder und Jugendlichen, ihre Aggressionen und Konflikte mit ihrem Umfeld. Sprachgenau, es wird viel berlinert, trifft Beate Dölling den Ton, der oftmals zwischen Eltern und Kindern herrscht.
In fast allen Fällen lernen die Kinder und Jugendlichen von ihren Müttern, wie das Leben läuft, können sich aus dem Teufelskreis der Abhängigkeiten nicht herausbewegen, wenn nicht jemand da ist, der ihnen hilft, ein Lehrer, ein Sozialarbeiter oder jemand anderes.\r\nUm die Arche, die Anlaufpunkt für viele arme Kinder ist, drehen sich die Geschichten nie. Sie wird zwar erwähnt, spielt aber inhaltlich keine Rolle. Handlungsort sind oftmals die vom Fernseher dominierten, mit schmutzigen Kleidern oder Essensresten vollgestopften kleinen Wohnungen, in denen sich das tägliche, unausweichliche Leben abspielt.
Beate Dölling hat Kindern und Jugendlichen ein Gesicht gegeben, indem sie von ihren Schicksalen erzählt und dafür sorgt, dass man sie so schnell nicht vergessen wird!
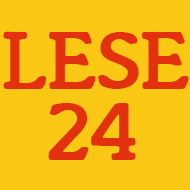
Schreibe einen Kommentar