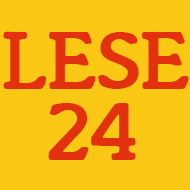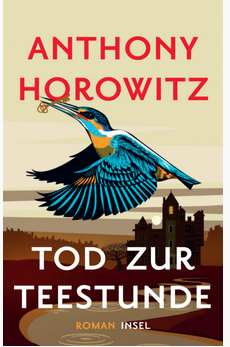Anthony Horowitz: Tod zur Teestunde, Aus dem Englischen von Lutz – W. Wolff, Insel Verlag, Berlin 2025, 572 Seiten, €25,00, 978-3-458-64515-3
„Das ist das Problem bei Kriminalromanen. Der Anfang, die Charaktere und alles andere können noch so brillant sein – am Ende hängt alles vom letzten Kapitel ab. Erst wenn der Leser da ankommt, entscheidet er sich, ob ihm das Buch gefallen hat oder nicht.“
Keine Frage, auch in diesem Band ist das letzte Kapitel eindeutig das Highlight. Allerdings verschachtelt Anthony Horowitz gleich mehrere Handlungsstränge mit vielen Figuren in seinem Roman und am Ende verfasst sogar ein Londoner Ermittler das letzte Kapitel der fiktiven Geschichte in der fiktiven Geschichte. Klingt alles sehr kompliziert und ist es am Ende auch, denn mehrere Morde in drei verschiedenen Zeitebenen und Handlungen geschehen und müssen letztendlich im Kreis der Verdächtigen aufgeklärt werden.
In dieses Dunkel kann nur die erfahrene, freiberufliche Lektorin Susan Ryeland Helligkeit bringen. Sie hat ihr Leben auf Kreta aufgegeben, wohnt nun wieder in London und braucht Arbeit. Wie auch in den Vorgängerbänden mit Susan als Hauptfigur ( Eine Rezension ist in diesem Literaturblog zu finden: http://karinhahnrezensionen.com/lese24/der-tote-aus-zimmer-12/ ) verfolgt die Fünfundfünzigjährige der ermordete Starautor Alan Conway und seine erfolgreiche Reihe um den Detektiv Atticus Pünd. In ihrem neuen Verlag Causton Books soll nun ein Sequel mit dem Titel „Pünds letzter Fall“ erscheinen, den Susan lektorieren soll. Als Autor hat der Verlag Eliot Crace unter Vertrag genommen. Zwar floppten seine beiden Krimis und ein nicht gerade guter Ruf eilt ihm voraus, aber der talentierte wie lässige Eliot bekommt seine Chance und Susan die ersten Kapitel des neuen Romans. Dass er eine Plage ist, ahnt Susan schnell, denn der reiche Lebemann ist der Enkel der weltberühmten Kinderbuchautorin Miriam Crace, die mit ihrer „Little People“ – Reihe ganze Generationen beglückt hat. Gut vermarktet erwarten die Crace – Erben ein lukratives Angebot von Netflix für mehrere Verfilmungen.
Eliots Handlung spielt im Jahr 1955 in Südfrankreich und im Zentrum der Geschichte steht eine wohlhabende dysfunktionale Familie. Atticus Pünd trifft Lady Chalfont vor ihrer Reise nach Nizza ausgerechnet beim Arzt. Beiden bleibt nicht mehr viel Lebenszeit und Lady Chalfont lädt Pünd ein, da sie seine Hilfe benötigt. Doch bevor Pünd noch ihre Villa betreten kann, wird sie beim Nachmittagstee vergiftet. Zeitgleich trifft auch ihr Anwalt ein, da dieser wohl ihr Testament ändern sollte.
Mit einem Cliffhanger versehen endet das erste Manuskript von Eliot Crace, der sich als schwieriger Autor herausstellt und Susans Arbeit als Lektorin kaum schätzt. Ziemlich schnell wird auch deutlich, dass Eliot in seinem Roman Figuren auftreten lässt, die fast eins zu eins denen seiner eigenen Familie ähneln. Wie Alan Conway spielt Eliot Crace, der allzu viel trinkt und auch Drogen konsumiert, gern mit Anagrammen. Nach Susans Recherchen, die ihr gar nicht behagen, verarbeitet Eliot in diesem Sequel rund um Lady Chalfont die seiner eigenen Familie rund um die Matronin Miriam Crace. Sie hat ihre Familienmitglieder dazu genötigt, mit ihr in einem dunklen Schloss namens Marble Hall in Wiltshire zu wohnen. Natürlich darf die Öffentlichkeit dies nie erfahren, aber die scheinbar gutherzige Kinderbuchautorin, die sehr viel Geld für Kinderheime gespendet hat, war eine kaltherzige, manipulative wie niederträchtige Person. Sie hat ihren Kindern, Enkeln und ihrem Adoptivsohn das Leben zur Hölle gemacht. Mit ihrem Geld konnte sie alle in Schach halten und an sich binden. Als sie starb, war Eliot zwölf Jahre alt, doch seine Erinnerungen und die Folgen der Tyrannei beschäftigen ihn bis heute. Susan würde am Manuskript gern einiges ändern, aber sie ahnt, dass Eliot Crace mit seinem fertigen Buch ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Er will Unruhe stiften, die Familienmitglieder schockieren, die Öffentlichkeit informieren und so behauptet er auch, dass Miriam Crace im hohen Alter kaum eines natürlichen Todes gestorben sei. Auch sie wurde wie Lady Chalfont vergiftet. Nach einem Eklat bei einer Familienfeier zu Ehren der angeblich so bewunderten wie berühmten Großmutter wird deutlich, Eliot geht es um Rache und um alte Rechnungen, die es zu begleichen gilt. Er behauptet, er würde den Mörder seiner Großmutter kennen und in seinem neuen Roman entlarven. Doch kaum ist die Drohung ausgesprochen, überfährt ihn ein Auto. Warum nun ausgerechnet Susan als Verdächtige befragt wird, kann sie sich kaum erklären, denn Eliot und sogar der Verlagsleiter haben ihr sehr deutlich gesagt, dass sie als Lektorin nicht mehr erwünscht ist. Aber so schnell gibt Susan nicht auf und wird mit Hilfe des sympathischen Detective Inspector Blakeney am Ende den Mörder stellen, der zum einen Miriam Crace und als Parallelfigur im Roman auch Lady Chalfont vergiftet hat.
Whodunit – Romane auf zwei Ebenen zu erzählen, ist schon eine Herausforderung, zumal auch noch Nebenhandlungen, u.a die Vorgeschichte und tragische Geschehnisse zwischen Susan und dem ziemlich unangenehmen Autor Alan Conway untergebracht werden müssen und unterschiedliche wie überzeugende Motive für die Morde. Außerdem streift Anthony Horowitz auch noch die finanziellen Untiefen und Abhängigkeiten des Verlagswesen, die Kunst des Lektorierens und bringt seine Hauptfigur Susan wiedermal ungewollt in lebensbedrohliche Situationen.
Wie immer, spannend bis zur letzten Seite!