Margaret Forster: Das dunkle Kind, Aus dem Englischen von Saskia Bontjes van Beek, Arche Verlag, Hamburg 2014, 316 Seiten , €22,95, 978-3-7160-2699-1
„Ihre Kindheit schien voller Rätsel zu sein, von denen die meisten unbedeutend, manche hingegen wichtig waren, ohne dass sich irgendeines bis heute lösen ließe.“
Julia ist ein stilles Kind, mit dem nie gesprochen wird. Ihre verhärmte, despotische Mutter bellt nur Befehle, fordert die Kontrolle über jeden ihrer Schritte und schickt sie einfach weg, wenn es wichtig wird. Als Julia als Teenager sich endlich erheben will, stirbt die Mutter. Als Kind verkriecht das Mädchen sich in ihrer Angst und muss die Erfahrung machen, dass sie in einem Moment, in dem sie mal eine eigene Entscheidung fällt, etwas Schreckliches geschieht. Als sie acht Jahre alt ist, fährt sie Klein Reggie, den Sohn ihrer Cousine Iris, im Babywagen durch die Straße, obwohl sie im Garten bleiben sollte. Der Kinderwagen kippt an der Bordsteinkante um. Das Baby schlägt mit dem Kopf leicht auf. Am kommenden Tag ist es tot. Julias Gewissensbisse der Mutter und den fragenden Polizisten gegenüber sind kaum auszuhalten, aber sie schweigt aus Angst vor den Folgen, für die Mutter und sich selbst.
Sehr viel später erfährt Julia, dass das Kind an Atemstillstand gestorben ist. Aber zu diesem Zeitpunkt sind bereits viel zu viele Dinge völlig falsch gelaufen.
Margret Forster strukturiert ihren Roman auf zwei Ebenen – zum einen erzählt sie chronologisch von Julias Kindheit und Jugend aus der Perspektive Julias, zum anderen zeigt sie ihre Hauptfigur als 48-jährige Psychologin, die in ihrer Praxis sich mit den Verhaltensauffälligkeiten von Mädchen im Alter zwischen acht und zehn Jahren beschäftigt. Julia erscheint zu Beginn als eingeschüchtertes Mädchen, entwickelt sich aber im Laufe der Zeit zu einer unausstehlichen Pubertierenden, die ihre Verwandten, Iris hat sie in der Familie nach dem Tod der Mutter aufgenommen, tyrannisiert. Julia fühlt sich in der lauten Familie ihrer Cousine nicht wohl, sie hat keinen Freiraum für sich, wird von Iris Töchtern permanent vereinnahmt und traut sich nicht ihre Freundin mit nach Hause zu bringen. Dabei begegnet die Familie ihr mit Aufmerksamkeit und Zuneigung. Belastend empfindet Julia auch, dass sie allen dankbar zu sein hat und steigert sich in dieses Gefühl so sehr hinein, dass sie mit 18 Jahren, nach vielen Boshaftigkeiten, Diebstählen und Betrügereien, ohne einen Blick zurück das Haus verlässt.
Mehr und mehr wird deutlich, dass alle Verfehlungen junger Mädchen, mit denen sich Julia in ihrer Praxis auseinandersetzen muss, ihr selbst recht gut bekannt sind. Julia schottet sich als Erwachsene vor den Kollegen oder möglichen Freunden ab. Sie scheut Begegnungen mit Menschen, geht sogar auf Distanz zu ihrer Freundin, die sie zu ihrer Hochzeit einlädt.
Als Friedensrichterin wiederum erhebt sie sich über die Verfehlungen der anderen und erkennt doch auch ihre eigene, immer wieder hinausgeschobene Schuld, die sie je älter sie wird immer mehr belastet.
„Natürlich würde sie nichts sagen. Ein solches Geständnis wäre bloß ein Zeichen der Schwäche.“
Margret Forster begibt sich wieder auf ein schwieriges Terrain. Sie erzählt in einem ruhigen und sachlichen Ton von den Untiefen der menschlichen Natur und der Hartnäckigkeit des Gewissens.
Und sie wirft die Frage auf, warum Menschen Dinge tun, die sie unzweifelhaft als falsch erkennen und die, wenn sie auffliegen, ihr ganzes Lebenskonstrukt ins Wanken bringen müssen. Julia kann vieles auch mit Bedauern klären, aber vieles liegt auch in ihrer Kindheit begründet. Sie will die Mädchen, die in ihre Praxis kommen, in ihren Entscheidungen bestärken, ihnen zuhören.
„Hilfe im entscheidenden Moment – das war es, was sie brauchten. Hilfe, die ihr selbst nicht gewährt worden war.“
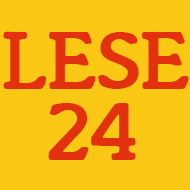
Schreibe einen Kommentar